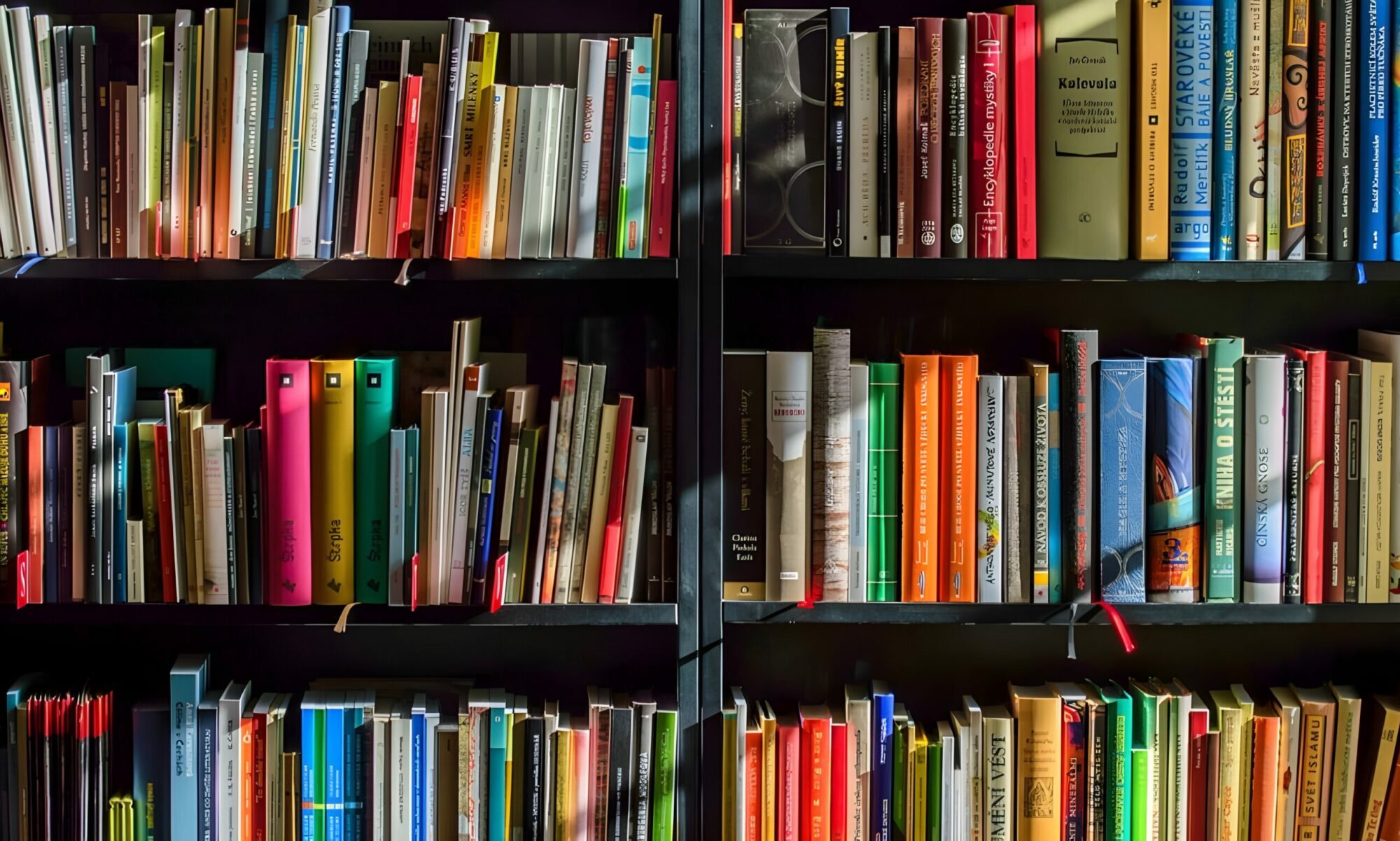„Wir sind in der ungefähr zehntausendjährigen Geschichte das erste Zeitalter, in dem sich der Mensch völlig und restlos problematisch geworden ist: in dem er nicht mehr weiß, was er ist; zugleich aber auch weiß, dass er es nicht weiß.“
(Max F. Scheler | Die Sonderstellung des Menschen im Kosmos, 1928)

Wer bin ich überhaupt? Diese Frage beschäftigt nicht nur mich, sondern ist wohl eine menschliche Grundsatzfrage. Aber nun zu mir: Zu allererst bin ich Mensch und das ändert auch der bei mir festgestellte Intelligenzquotient (IQ) von 141 und die mir attestierte Hochbegabung nichts. Immer schon war ich ein Fragender und das wird sich zeit meines Lebens auch nie ändern. Bereits als Kind wollte ich die Welt und ihre Abläufe bis ins Kleinste verstehen und habe nach fundierten und überzeugenden Antworten gesucht. Der nächtliche Blick zum Himmel und zu den Sternen und die Geheimnisse, die dort auf ihre Lösungen warten, haben mich stets gefesselt. Bedeutend für mich war eine Begegnung zwischen einem Mathematikprofessor und mir im Jahr 2011. Dieser machte mich auf das bisher ungelöste Problem der sog. „Riemannschen Vermutung“ innerhalb der Mathematik aufmerksam. Diese Hypothese beeindruckt mich bis heute.
Die Folgen meiner Wissbegierigkeit? Häufiges Lesen, das Beobachten, das An- und Bezweifeln und das prüfende und vergleichende Nachdenken und Erforschen von Vorgängen in der Welt. Diese intensive Suche nach Wahrheit führte mich schlussendlich an die Universität, wo ich zu studieren begonnen habe. Meine Intention: Ich möchte die Umwelt, ihre Abläufe und die Kausalzusammenhänge besser verstehen – die „Big Questions“ des Lebens also. Dass dies kein einfacher Weg werden würde, ahnte ich, und dass mein Wissenstrieb nie völlig gestillt werden kann, wusste ich. Apropos Hinterfragen: Die Frage, warum der Mensch sich in vielerlei Hinsicht über Tiere stellt, hat mich zum Denken darüber angeregt. Mit 16 Jahren wurde ich so zum Vegetarier, seit vielen Jahren lebe ich völlig vegan. Auch das war ein persönlicher Entwicklungsschritt.

Und meine Studienzeit? Diese war sodann geprägt von der Faszination gegenüber dem Staat, seiner Ordnungspolitik, dem Recht und den Zielen und Zwecken regulatorischer Funktionen. Gleichzeitig war es für mich von Bedeutung, immer auch „hinter die Kulissen“ zu blicken und den Menschen als Individuum und die damit verbundenen Handlungen zu hinterfragen. Diese Auseinandersetzung, die schon seit der griechischen Antike ein Grundpfeiler der Erkenntnis ist, lenkte mein Interesse zunehmend auf ethische und moralische Elemente. So fand ich neben den Rechts-, Verwaltungs- und Wirtschaftswissenschaften auch zur Philosophie und erkannte Recht, Ökonomie und Philosophie als sich inter- und multidisziplinär ergänzende Forschungsgebiete. Philosophisch ausgedrückt: Alles fließt, πάντα ῥεῖ.
Wohin mit meinem inneren Wissensdurst? Dieser führte mich beruflich über mehrere Umwege in den wissenschaftlich-akademischen Sektor – und in der wissenschaftlichen Forschung und Lehre fand ich meine Heimat. Die genannten Disziplinen bilden heute meine wissenschaftlichen Spezialgebiete, die, wie ich finde, nie wirklich zu Ende studiert werden können. Mein wissenschaftliches Interesse gilt im Speziellen den unterschiedlichen Konnexen zwischen der wirtschafts- bzw. verwaltungswissenschaftlichen Disziplin, dem rechtswissenschaftlichen Bereich und dem Fachgebiet der Philosophie. Im Hinblick auf meine präventionstheoretische Forschung setze ich mich mit der Verbindung von Ökonomie, Recht und Psychologie auseinander und untersuche, welche zentrale Stellung dabei die Moral einnehmen kann. Im Kontext meiner Promotion beschäftigte ich mich intensiv mit Fragen der Wirtschaftskriminalität und dem Phänomen der Bilanzfälschung. Dabei versuchte ich, positivrechtliche Aspekte mit moralischen und rechtsphilosophischen Fragestellungen, vor dem Hintergrund der Durchführung doloser Handlungen, zu verknüpfen.

Und nun? Nach mehreren wissenschaftlichen Stationen, folgte ich im Jahr 2023 dem Ruf an die FH Campus Wien – University of Applied Sciences. Seitdem lehre und forsche ich ebendort als Habilitand (PostDoc) am Department für Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit und Politik und am Research Center Administrative Sciences (RCAS). Aktuell gilt mein Forschungsinteresse im Besonderen den facettenreichen Phänomenen der sog. „Reichsbürger:innen-Gruppierungen“ in Österreich und Deutschland und ihren Beziehungen zu Staat, Recht und Verwaltung. In diesem Forschungsgebiet verfasse ich derzeit meine Habilitationsschrift und bin hierfür u. a. Mitglied der Forschungsgruppe „Extremismus – Terrorismus“ des Kölner Forums für Internationale Beziehungen und Sicherheitspolitik (KFIBS). Im Sommer 2024 forsche ich zur Habilitationsthematik an der renommierten Harvard University in Cambridge, Massachusetts (USA).
Letztendlich: Wissenschaft ist für mich in aller erster Linie Berufung, wo der Bezug zur Theorie ebenso unerlässlich ist wie jener zur Realität. Oft entlarvt sie sich in vielen Bereichen als die Fähigkeit des aktiven Zuwartens. Die Ziele Freiheit und Wahrheit als Grundprinzipien der Gerechtigkeit sind für mich sowohl in Lehre als auch in Forschung von größter Bedeutung. Und die Welt ist bunt. Wer nur im Gestern lebt, wird das Heute und Morgen nie wirklich verstehen können. Daher Mensch, vergiss nie, dass du schlicht Mensch bist. Die Welt muss von uns allen ertragen werden. Frei nach Descartes: Ego sum, ego existo.